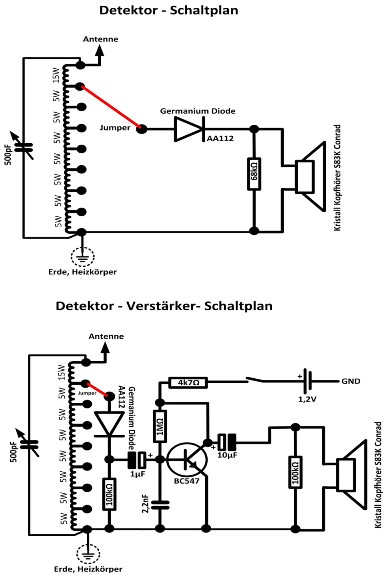
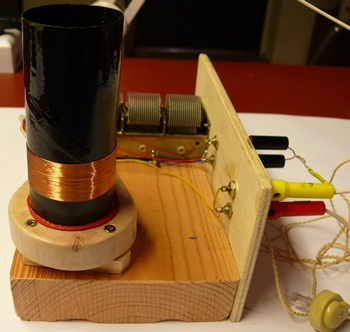
 Die Germaniumdiode! Beim Gleichrichten spielt die Schwellenspannung
der Diode eine bedeutende Rolle, denn über die Diode fließt ja auch in Durchlaßrichtung
nur dann ein Strom, wenn die angelegte Spannung die Schwellenspannung der Diode überschreitet.
Daher ist für diese Gleichrichtung eine Germaniumdiode (AA112) mit ihrer niedrigen
Schwellenspannung (0,2V) erforderlich.
Die Germaniumdiode! Beim Gleichrichten spielt die Schwellenspannung
der Diode eine bedeutende Rolle, denn über die Diode fließt ja auch in Durchlaßrichtung
nur dann ein Strom, wenn die angelegte Spannung die Schwellenspannung der Diode überschreitet.
Daher ist für diese Gleichrichtung eine Germaniumdiode (AA112) mit ihrer niedrigen
Schwellenspannung (0,2V) erforderlich. Der Kopfhörer muss hochohmig sein. Einen 2000 Ohm Kopfhörer
besitze ich nicht und diese sind schwer zu bekommen. Als Ersatz können kleine Kristallkopfhörer
benutzt werden. Für den Anschluss am Detektor muss ein 68 bis 100 kΩ Widerstand parallel
geschaltet werden. Bei der Firma Conrad Elektronik
kann man so einen Kopfhörer für 3.- Euro kaufen.
Der Kopfhörer muss hochohmig sein. Einen 2000 Ohm Kopfhörer
besitze ich nicht und diese sind schwer zu bekommen. Als Ersatz können kleine Kristallkopfhörer
benutzt werden. Für den Anschluss am Detektor muss ein 68 bis 100 kΩ Widerstand parallel
geschaltet werden. Bei der Firma Conrad Elektronik
kann man so einen Kopfhörer für 3.- Euro kaufen.
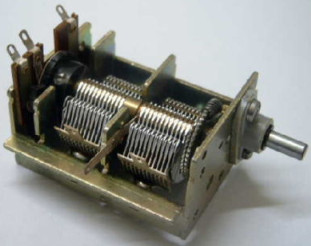 Drehkondensator 500pF. Wird eine Sendereinstellung bei sehr eng
beieinander liegenden Sendefrequenzen erforderlich, so kann der normale Drehwinkel von
180 Grad von Drehkondensatoren für eine manuelle Abstimmung zu grob sein.
In solchen Fällen erfolgt der Antrieb über ein möglichst spielfreies Untersetzungsgetriebe.
Mein Drehkondensator besitzt so ein Getriebe und verfügt über eine einstellbare Kapazität von 2 x 280pF.
Drehkondensator 500pF. Wird eine Sendereinstellung bei sehr eng
beieinander liegenden Sendefrequenzen erforderlich, so kann der normale Drehwinkel von
180 Grad von Drehkondensatoren für eine manuelle Abstimmung zu grob sein.
In solchen Fällen erfolgt der Antrieb über ein möglichst spielfreies Untersetzungsgetriebe.
Mein Drehkondensator besitzt so ein Getriebe und verfügt über eine einstellbare Kapazität von 2 x 280pF.
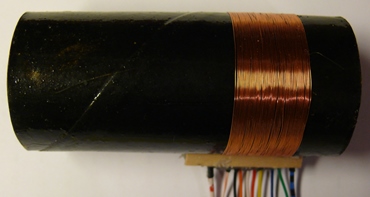 Die Spule. Wenn ich mit einem Drehkondensator 500pF den gesamten
Mittewellenbereich überstreichen will, benötige ich eine Schwingkreisinduktivität von
L=180µH. Als Spulenkörper dient eine Toilettenpapier-Papprolle.
Wie viel Windungen brauche ich? Bei zylindrischen Luftspulen berechnet
man die Induktivität nach der Formel:
Die Spule. Wenn ich mit einem Drehkondensator 500pF den gesamten
Mittewellenbereich überstreichen will, benötige ich eine Schwingkreisinduktivität von
L=180µH. Als Spulenkörper dient eine Toilettenpapier-Papprolle.
Wie viel Windungen brauche ich? Bei zylindrischen Luftspulen berechnet
man die Induktivität nach der Formel:
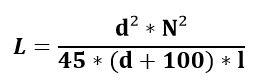
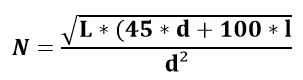
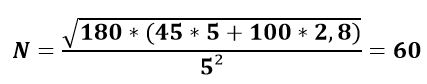 Die Spule muss sechzig Windungen haben. Damit ich auch richtig experimentieren kann, habe ich
neun Anzapfungen zu je fünf Windungen vorgesehen. Ein geduldig optimierter Detektor ist
erstaunlich leistungsfähig. Als Spulendraht habe ich lackierten Kupferdraht 0,28 mm Durchmesser genommen.
Will man einen Detektor für Kurz- und/oder Mittelwelle bauen, muss man sich den Frequenzbereich anschauen.
Anfangs habe ich von einer Spuleninduktivität von 180µH gesprochen. Wie kommt man auf so einen Wert?
Die Mittelwelle liegt bei 500 bis 1600 kHz. Ein Drehkondensator mit einer Kapazität
von 500pF dient hier als Ausgangsgröße.
Die Spule muss sechzig Windungen haben. Damit ich auch richtig experimentieren kann, habe ich
neun Anzapfungen zu je fünf Windungen vorgesehen. Ein geduldig optimierter Detektor ist
erstaunlich leistungsfähig. Als Spulendraht habe ich lackierten Kupferdraht 0,28 mm Durchmesser genommen.
Will man einen Detektor für Kurz- und/oder Mittelwelle bauen, muss man sich den Frequenzbereich anschauen.
Anfangs habe ich von einer Spuleninduktivität von 180µH gesprochen. Wie kommt man auf so einen Wert?
Die Mittelwelle liegt bei 500 bis 1600 kHz. Ein Drehkondensator mit einer Kapazität
von 500pF dient hier als Ausgangsgröße.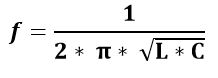
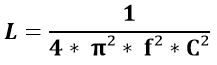 Mit der Thomsonschen Schwingungsgleichung kann man nun die Induktivität berechnen.
Mit der Thomsonschen Schwingungsgleichung kann man nun die Induktivität berechnen.Detektor Radio © 2000 Hans Busche